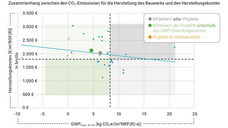Auf der vergangenen Frühjahrstagung des Ausschusses Technik Werkstoff Umwelt sowie der Sachverständigen-Obleute standen u. a. Neuerungen der BEG-Förderung und das Gebäudeenergiegesetz im Fokus. Die Teilnehmenden blicken auf eine informative Veranstaltung in der Adolf Wilhelm Keim Akademie zurück.
Nach einer kurzen Vorstellung des Unternehmens Keimfarben durch den Geschäftsführer Rüdiger Lugert, konnten die Teilnehmenden der Tagung im Technikum des Unternehmens das Keim-Produkt „Twinstar“ testen. Dabei handelt es sich um eine 2-in-1-Beschichtung für Fassaden, die zwei Anstriche in einem Arbeitsgang ohne Zwischentrocknungszeit ermöglicht. Ob das Produkt dieses Versprechen halten kann, wollten die Sachverständigen und technischen Berater des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz herausfinden.
BEG EM und GEG im Fokus
Nach dem Produkttest startete die Vortragsreihe. Top 1 auf der Tagesordnung: wichtige Neuerungen zur BEG-EM Förderung sowie zum GEG. Mit der Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen gibt es für die Sanierung von Gebäuden, die dauerhaft Energiekosten einsparen und damit das Klima schützen, Unterstützung. Gegenüber der Förderrichtlinie vom 30. Dezember 2022 haben sich die Höchstgrenzen förderfähiger Ausgaben in der BEG geändert.
Für Wohngebäude (WG) gelten folgende Höchstgrenzen für die förderfähigen Maßnahmen:
1. für Wärmeerzeuger (pro Gebäude):
- 30.000 € für die 1. Wohneinheit
- 15.000 € für die 2.- 6. Wohneinheit
- 8.000 € ab der 7. Wohneinheit
2. für energetische Sanierungsmaßnahmen (Gebäudehülle, Anlagentechnik (ohne Heizung), Heizungsoptimierung (pro Gebäude und Kalenderjahr)):
- 30.000 € pro Wohneinheit
- zusätzlich 30.000 € pro Wohneinheit, wenn ein geförderter iSFP aus dem Förderprogramm EBW vorliegt.
Der Referent, Walter Bücher, ging auf die Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle genauer ein. Denn die technischen Mindestanforderungen für förderfähige Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudehülle bleiben gegenüber der vorhergehenden Förderrichtlinie, wie auch im GEG 2023, unverändert. So ist bei Sanierungsmaßnahmen – insbesondere an der wärmeübertragenden Gebäudehülle – stets zu prüfen, ob Maßnahmen zum Feuchteschutz, vornehmlich zur Vermeidung von Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung durch Einhaltung des Mindestluftwechsels und des Mindestwärmeschutzes in Zusammenhang mit der Sanierungsmaßnahme erforderlich sind.
Bei Wohn- und Nichtwohngebäuden ist bei allen Maßnahmen auf eine wärmebrückenreduzierte und luftdichte Ausführung zu achten. Folgende Anforderungen an die Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) sind bei dem jeweiligen Bauteil für eine Förderung als Einzelmaßnahme einzuhalten. Die Anforderungen beziehen sich nur auf die wärmeübertragenden Umfassungsflachen. Für die Außenwand bei Erneuerung, Ersatz oder erstmaligem Einbau von Bauteilen der thermischen Gebäudehülle bei Wohngebäuden 0,20 W/(m²K).
Wichtig zu beachten ist, dass sich das Antragsverfahren für die Zuschussförderung über die BAFA wesentlich geändert hat. Der antragstellende Auftraggeber muss vor Antragstellung mit dem ausführenden Fachunternehmen einen Lieferungs- oder Leistungsvertrag schließen, der zum einen ein voraussichtliches Ausführungsdatum und zum anderen aufschiebende oder auflösende Bedingungen der Förderzusage (§ 158 BGB) beinhalten muss.
- Bei Aufnahme einer „aufschiebenden Bedingung“ wird der geschlossene Leistungs- Werk-)vertrag erst wirksam, wenn der Auftraggeber (Antragsteller) eine Förderzusage erhält. Der Fachunternehmer kommt also nicht in Ausführungsverzug, solange keine Förderzusage vorliegt.
- Bei Aufnahme einer „auflösenden Bedingung“ verliert der geschlossene Leistungs- (Werk-)vertrag seine Rechtsgültigkeit, wenn keine Bewilligung der Förderung erteilt wird, der Vertrag wird aufgelöst.
Der ausführende Betrieb trägt alleine das „Ausfall“-Risiko, wenn der Antragsteller keine Förderzusage erhält. Wenn z. B. benötigtes Material bestellt oder bereits Personal disponiert wurde, ohne dass die Förderzusage bereits vorliegt, ist dies ein Risiko für das Fachunternehmen. Daher sollte der Betrieb eine vertragliche Vereinbarung mit dem Antragsteller treffen. Ebenfalls macht es Sinn, das Datum der voraussichtlichen Ausführung zeitlich möglichst weit vom Antragsdatum zu legen. So kann der Auftraggeber sicherstellen, dass die Zuschusszusage tatsächlich beim anvisierten Ausführungstermin vorliegt.
Das birgt aber wiederum die Gefahr, dass durch den gestreckten zeitlichen Ablauf z. B. Materialpreise seitens der Hersteller erhöht werden, Lohnkosten durch neue Tarifverträge steigen oder es zu Lieferengpässen wegen Material- oder Rohstoffknappheit kommt. Dies sollte, soweit möglich, bei der Kalkulation berücksichtigt werden.
Beim Erstellen des Leistungsvertrags sollten folgende Vereinbarungen beinhaltet sein:
- Der Antragsteller verpflichtet sich, innerhalb von […] Tagen nach Vertragsabschluss den Antrag beim Durchführer (hier BAFA) zu stellen. Für den Zeitpunkt der Antragstellung ist das Datum des Eingangs des Antrags beim Durchführer maßgeblich.“
- Der Antragsteller verpflichtet sich, den Auftragnehmer unverzüglich innerhalb von […] Tagen über die Zusage oder die Ablehnung des Förderzuschusses zu informieren und im Falle der Ablehnung des Förderantrags dem Fachunternehmen den Ablehnungsbescheid vorzulegen.
WDVS an Untersichten
Die Informationsbroschüre zu WDVS an Untersichten bietet Hilfestellung für die Planung, Bemessung und Ausführung von Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) an Untersichten mit einer Tiefe von mehr als 1m gemäß den geltenden allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (aBZ) oder allgemeinen Bauartgenehmigungen (aBG).
Untersichten sind im Allgemeinen die horizontalen Unterseiten von Gebäude- oder Bauteilen, die eine Tiefe von mehr als 1 m aufweisen. Horizontalflächen mit einer Tiefe von weniger als 1 m erfordern keine spezielle Betrachtung. Für WDVS, die an solchen Stellen angebracht werden, können jedoch separate Überlegungen zur Bemessung erforderlich sein.
Weiteres Thema war die Verwendbarkeit von Baustoffen aus Polystyrol bei horizontalem Einbau. In der im April 2023 veröffentlichten Ausgabe 2023/1 der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) wurde im Anhang 4 zur Brandverhaltensklassifizierung von Bauprodukten und Bauarten ein neuer Abschnitt aufgenommen.
Dieser enthält spezielle Regelungen zur Verwendung von Baustoffen aus Polystyrol bei horizontalem Einbau. Zahlreiche Anfragen aus der Baupraxis zeigen, dass es bei der Auslegung des Abschnittes unterschiedliche Interpretationen gibt. In Abstimmung mit den zuständigen Gremien der Bauministerkonferenz wird daher nachfolgender Hinweis veröffentlicht.
Der seit der Ausgabe 2023/1 der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen enthaltene Abschnitt 14 des Anhangs 4 (Technische Regel zu A 2.2.12 Bauprodukte und Bauarten) betrifft die Verwendung von Baustoffen aus bzw. Verbundbaustoffen mit Polystyrol bei horizontalem Einbau in baulichen Anlagen, sofern für diesen Anwendungsbereich die bauaufsichtliche Anforderung „schwerentflammbar“ an die verwendeten Baustoffe besteht. Dies trifft auf Gebäude der Gebäudeklassen 1, 2 und 3 in der Regel nicht zu.
In Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5 bzw., bei Sonderbauten ist die Schwerentflammbarkeit der verwendeten Baustoffe aufgrund bauaufsichtlicher Vorschriften oder bauaufsichtlich genehmigter Brandschutz-konzepte bei ausgewählten Bauteilen gefordert. Abweichende landesrechtliche Regelungen bleiben hiervon unberührt.
Arbeiten an schadstoffbelasteten baulichen und technischen Anlagen
Bei Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gilt es, besondere Schutzmaßnahmen zu planen. Bislang gab die VOB/C in der ATV DIN 18299 hier nur eine geringe Hilfestellung für den Ausschreibenden.
Das bedeutet, dass Vertragsparteien in Werkverträgen im Bereich Bauen im Bestand Regelungen zum Umgang mit im Objekt vorhandenen Kontaminationen einzelvertraglich regeln mussten, weil keine Regelleistungen vorgegeben waren. Durch die ATV DIN 18448 „Schadstoffsanierungsarbeiten“ soll sich dies ändern, denn sie stellt eine Gewerke-übergreifende Regelung zum Umgang mit schadstoffbelasteten Gebäuden dar. Umfassende Angaben für den Auftraggeber sind in Abschnitt 0 zu finden.
Dazu sagt der Obmann des Arbeitsausschusses zur ATV DIN 18448 Christoph Hohlweck in VOB Aktuell, Ausgabe IV 2023: Obgleich für den eigentlichen Werkvertag nicht normativ, kommt diesem Abschnitt gerade bei den Arbeiten an schadstoffbelasteten baulichen und technischen Anlagen besondere Bedeutung zu. Wie bei anderen Werkverträgen auf Grundlage der VOB auch, müssen alle für die Ausführung der Arbeiten erforderlichen Leistungen in der Leistungsbeschreibung aufgeführt sein. Neben diesen rein bautechnischen Inhalten der Leistungsbeschreibung ergeben sich aus verschiedenen Bauherrenpflichten, die speziell bei Arbeiten mit Schadstoffen an den Auftraggeber adressiert sind, weitere Inhalte, die in der Leistungsbeschreibung zu berücksichtigen sind. Insofern dient der Abschnitt 0 dieser Norm nicht zuletzt auch dem Bauherrn dabei, seinen speziellen Bauherrenpflichten im Zusammenhang mit vorhandenen Kontaminationen gerecht zu werden.
Die ATV DIN 18448 adressiert hier außerdem ganz klar die Bauherrenpflichten, dass: Art, Lage, räumliche Verteilung der schadstoffbelasteten Bauteile bzw. Bauprodukte im Arbeitsbereich und Ergebnisse der durchgeführten Schadstoffuntersuchungen (Schadstoffkataster) vom Auftraggeber angegeben werden müssen und die Erkundung nach Schadstoffen nicht Sache des Auftragnehmers ist.
Weitere Themen
Im Rahmen der Tagung standen auch weitere Themen auf der Tagesordnung: Kein Verkauf von CMR-Stoffen an Privatkunden, ATV DIN18340 Vorsatzschalen Aufmaß, Überarbeitung VOB /C ATV DIN 18363, DIN18448, WHG-Aufzüge Fachbetriebspflicht, Laga M23 Merkblatt Abfall Asbest – Wann ist Abfall asbesthaltig?
BFS-Präsident Michael Eichler präsentierte den Bericht des Ausschusses und stellte die neue Webseite (www.farbe-bfs.de), App sowie Merkblätter vor. Auch die Bundesfachgruppen Fußbodentechnik und Putz Stuck Trockenbau berichteten über Neuerungen in diesen Bereichen.
Weitere Informationen zu den Themen der Tagung erhalten Interessierte über die technischen Berater der Verbände.